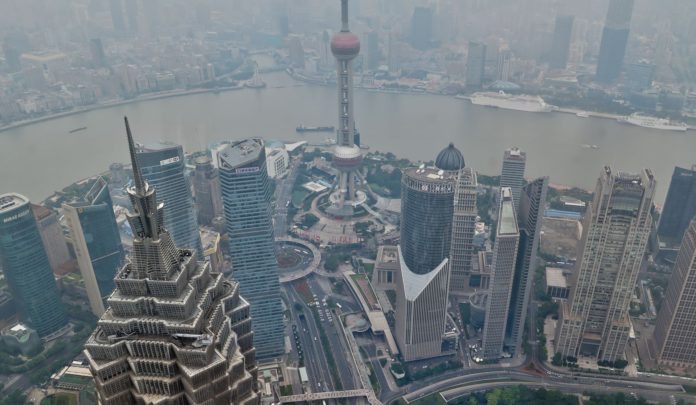Berlin, Deutschland (Weltexpress). Seit sich das Wachstum in China bei mittleren einstelligen Werten einzupendeln scheint, klagen Unternehmen über den Ausfall der fernöstlichen Wachstumslokomotive, Politiker hingegen fürchten um ihre weltpolitische Vormachtstellung.
Es scheint, als hätten sie aus der Tatsache, dass der Chinaboom länger und stärker war als jede andere Wachstumsperiode in der Geschichte der Weltwirtschaft, den Schluss gezogen, dass er bis in alle Ewigkeit andauern müsste. Dabei schwächt sich das Wachstum schon seit über zehn Jahren ab, und es gibt keinen Grund zur Annahme, es gebe einen Weg zurück zu den zweistelligen Wachstumsraten aus der Zeit vor der Weltwirtschaftskrise 2008/2009. Ein Blick zurück auf die Anfangsphase des Booms hilft auch dessen Ende zu verstehen.
Weltmarktintegration unter staatliche Kontrolle
Seit der Schuldenkrise der 1980er drängten die Regierungen des Westens und Institutionen wie Weltbank und IWF Länder des Südens zu einem Schwenk von einer binnenorientierten Industrialisierung zu einer exportorientierten Entwicklung: Agrarprodukte und Massenprodukte gegen technologisch anspruchsvolle Waren aus den reichen Ländern. Auch China schlug nach ersten, auf den Binnenmarkt ausgerichteten, Marktreformen in den 80er Jahren den Weg der Weltmarktintegration ein.
Die Kommunistische Partei war bereit, dem Marktmodell des Westens zu folgen, allerdings unter ihrer Kontrolle: Grund und Boden blieben Staatseigentum. Bis heute. Grund und Boden kann, auch sehr langfristig, gepachtet aber nicht gehandelt werden. Kapital- und Devisenverkehr mit dem Ausland blieben unter staatlicher Kontrolle. Ausländische Investoren mussten sich auf Joint Ventures einlassen, die chinesischen Firmen Zugang zu fortgeschrittenen Technologien erlaubten.
Nicht gerade die Standortbedingungen, die sich westliche Investoren wünschten, aber der Zugang zu unschlagbar billiger und qualifizierter Arbeitskraft sowie einer halbwegs intakten Infrastruktur, ein Erbe der ursprünglichen Akkumulation in Maos China, machten diese Nachteile wett. Innerhalb weniger Jahre verwandelten sie einige Küstenregionen Chinas in die verlängerte Werkbank der kapitalistischen Welt. Die dafür benötigten Arbeitskräfte kamen aus dem agrarischen Hinterland. Der weiterbestehende Zugang zu Grund und Boden in ihren Heimatgemeinden erlaubte ihnen Selbst- bzw. Familienversorgung, wenn ihre Arbeitskraft in den Exportindustrien gerade nicht gebraucht wurde. Ein Faktor, der die Reproduktionskosten der Arbeitskraft niedrig hielt. Unterbringung in Massenunterkünften und extrem lange Arbeitszeiten waren weitere Faktoren.
Kein Zweifel: Die erfolgreiche Weltmarktintegration wurde durch Überausbeutung der chinesischen Arbeiterklasse erkauft. Daran waren nicht nur ausländische Firmen beteiligt. Die Weltmarktintegration ging mit einer Art »zweiten ursprünglichen Akkumulation« einher, in der alte Staatsbetriebe samt der von ihnen gewährten Sozialsysteme für die Belegschaften unter den neu geschaffenen Konkurrenzbedingungen zusammenbrachen, während neue chinesische Firmen entstanden, teils staatliche, teils private, aber in jedem Fall ohne die sozialen Absicherungen aus Maos Zeiten, die berühmte eiserne Reisschale.
Vom Merkantilismus zum Motor der Weltwirtschaft
Das Modell Weltmarktintegration durch Überausbeutung kam in den 1990er Jahren zunächst nur stotternd in Gang. In den frühen 2000ern explodierte es geradezu. Der Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt stieg innerhalb eines Jahrzehnts von Werten zwischen 20 und 30 Prozent seit den 60er Jahren auf 45 Prozent. Die Konsumquote sank von Werten zwischen 60 und 75 Prozent auf unter 50 Prozent. Der Anteil der Exporte stieg von 13,5 Prozent 1990 auf 21 Prozent im Jahr 2000 und schoss 2006 auf einen Höchstwert von 36 Prozent. Noch dramatischer entwickelte sich der Leistungsbilanzsaldo. 2000 betrug er noch 1,7 Prozent, 2007 über 10 Prozent.
Westliche Politiker hatten durchaus Grund, sich über Chinas merkantilistische Eroberung des Weltmarkts zu beklagen, obwohl westliche Unternehmen mit ihren Produktionsverlagerungen nach China erheblich dazu beigetragen hatten und Privathaushalte unter dem Druck schwacher oder gar rückläufiger Entwicklung der Realeinkommen gern zu Billigimporten aus Fernost griffen. In einigen Ländern, allen voran den USA, griffen sie auch immer mehr zu günstigen Konsumenten- und Immobilienkrediten, die zeitweilig durch den spekulativen Anstieg der Immobilienpreise ausgeglichen wurden. Das Platzen der damit verbundenen Immobilienblase gab den Anstoß zu einer globalen Finanz- und dann auch allgemeinen Wirtschaftskrise.
Damit kam auch der chinesische Merkantilismus an sein Ende. In bester keynesianischer Manier erhöhte die chinesische Regierung die Staatsausgaben und glich damit den Rückgang der Exporte aus. Die Ausgabensteigerungen waren so massiv, dass sie nicht nur die Konjunktur in China stabilisierten, sondern entscheidend zur Überwindung der Weltwirtschaftskrise beitrug.
Innerhalb kürzester Zeit wurde China zum Motor der Weltwirtschaft, zu dessen Wachstum es seit der Krise doppelt soviel beiträgt wie die USA. 2011 lag der Leistungsbilanzüberschuss Chinas nur noch bei 1,9 Prozent und schwankt seither um die 2-Prozent-Marke. Aber die Bruttoanlageinvestitionen stiegen weiter, weil die Staatsausgaben insbesondere in Infrastrukturprojekte flossen. Sie erreichten ihren Höchstwert von 45 Prozent erst 2013 und liegen gegenwärtig immer noch bei 42 Prozent.
Zur Konjunkturstabilisierung trug außerdem ein staatlich geförderter Immobilienboom bei, der die Sparquote der privaten Haushalte hoch- und ihre Konsumquote niedrig hält. Nach einem Anstieg auf 56 Prozent 2016 sank die Konsumquote während der Corona-Rezession wieder um zwei Prozentpunkte und ist auch nach Ende der Rezession nicht wieder gestiegen. Dafür ist, ähnlich der Entwicklung in den USA in den frühen 2000er Jahren, der Immobiliensektor von Überkapazitäten und Überschuldung geplagt. Nach nur wenigen Jahren stottert der Wachstumsmotor China.
Ein neues Entwicklungsmodell
Es kann allerdings auch sein, dass China die Rolle eines Wachstumsmotors gar nicht anstrebt, sondern von westlichen Eliten zugeschrieben bekam – aus Verzweiflung, weil die USA nach der Weltwirtschaftskrise in die Stagnation fielen. Die chinesische Partei- und Staatsführung erklärte schon kurz nach der Krise, dass sie keine Rückkehr zu den zweistelligen Wachstumsraten der Vorkrisenjahre anstrebe, dass sich ihre Prioritäten vom Wachstum um jeden Preis in Richtung eines sozialen Ausgleichs im Innern und der Schaffung einer multipolaren Weltordnung verlagerten, in der souveräne Staaten für freie und faire Wirtschaftsbeziehungen sorgen. Hegemoniestreben und Konkurrenz um Wachstumsraten und Weltmarktanteile hätten in dieser Vorstellung keinen Platz.
Ob die Schritte, die die chinesische Führung seit der Krise unternommen hat, sich als Schritte in eine solche Richtung erweisen, ist offen. Aus heutiger Sicht dominiert eine Politik des Durchwurstelns. Fiskal- und Geldpolitik sind auf die Stabilisierung der Konjunktur, nicht auf maximales Wachstum ausgerichtet. Der Zusammenbruch des überschuldeten Immobiliensektors soll ebenso verhindert werden wie die Entstehung neuer Spekulationsblasen.
Die immer noch bestehende staatliche Kontrolle über den internationalen Kapitalverkehr macht diesen Balanceakt etwas leichter und zugleich deutlich, dass die chinesische Führung den Renminbi keineswegs als Weltwährung, als Alternative zum Dollar an den Start bringen will. Dies würde freie Konvertierbarkeit erfordern, sodass internationale Anleger ihr Geld je nach Bedarf im sicheren Weltwährungshafen vor Anker bringen, aber auch jederzeit in jede Weltgegend transferieren können, in der sie profitable Investitionsprojekte wittern.
So schwierig der Balanceakt auch sein mag, über ein Jahrzehnt nach der großen Krise sollten außer fortlaufenden Einsätzen der Krisenfeuerwehr wenigstens Kernelemente einer Alternative zum Merkantilismus aus Vorkrisenzeiten erkennbar sein. Das Argument, Staatskontrolle sei notwendig gewesen, um den Zerfall der Volksrepublik und die Entstehung eines Kapitalismus zu verhindern, der ausschließlich auf der Aneignung vormaligen Staatseigentums beruht, mag man den chinesischen Kommunisten durchgehen lassen. Russland war in dieser Hinsicht ein abschreckendes Beispiel. Auch das Argument, zur Weltmarkteingliederung habe es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion keine Alternative gegeben und die Überausbeutung der chinesischen Arbeiterklasse sei der Preis für das Verhindern einer peripheren Eingliederung in einem vom Westen dominierten Weltmarkt gewesen, mag man akzeptieren.
Aber nachdem der lange Boom die Pro-Kopf-Einkommen aus der Armut geführt und technologische Kapazitäten geschaffen hat, die den Westen um seine Technologieführerschaft fürchten lassen, stellt sich die Situation anders dar. Jetzt müssen die chinesischen Kommunisten beweisen, dass sie Kommunisten sind, das Land aus einer Gesellschaft der Ausbeutung führen können und den Versuchungen der Großmachtpolitik widerstehen.
Anmerkung:
Vorstehender Beitrag von Ingo Schmidt wurde in „Sozialistische Zeitung“ (Soz Nr. 03/2024) erstveröffentlicht.
Anzeige:
Reisen aller Art, aber nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und mit Persönlichkeiten – auch Reisen durch die Volksrepublik China und die Republik China -, bietet Retroreisen an. Bei Retroreisen wird kein Etikettenschwindel betrieben, sondern die Begriffe Sustainability, Fair Travel und Slow Food werden großgeschrieben.