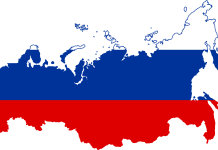Streitfälle um Zuschreibungen von Werken zu Künstlern oder Werkstätten gibt es oft und häufen sich auch zunehmend. Erinnert sei nur an jenes Werk in der Berliner Gemäldesammlung mit dem Namen „Mann mit dem Goldhelm“ welches über lange Zeit Rembrandt zugeschrieben wurde, während man heute ziemlich sicher zu sein glaubt, dass es lediglich aus seiner Werkstatt stammt, nicht aber von seiner Hand. Hinter diesen Zuschreibungsproblemen verbirgt sich die Geschichte der sozialen bzw. soziologischen Stellung des bildenden Künstlers oder Künstlers überhaupt.
In Teil 1 dieser Buchbesprechung war bereit von jenen Stifterfiguren die Rede, die kunst- und religionsgeschichtlich eben jenen Epitaphen vorausgingen. Die berühmtesten sind hier eben jene Stifterfiguren vom Naumburger Dom, von denen wiederum das schöne Edelfräulein namens Uta besondere Berühmtheit erlangte. Bei dem Schöpfer dieser Werke handelt es sich zweifelsohne nach unserem Verständnis um einen genialen Künstler. Sein Name ist uns unbekannt und wirft damit schon wieder die Zuschreibungsfrage auf, welche anderen bedeutenden Skulpturen der Zeit ebenfalls von diesem unbekannten Meister von Naumburg, wo er zweifellos nicht immer ansässig gewesen sein muss, stammen würden. Die Namenlosigkeit dieses Meisters ist aber keineswegs irgendeinem Unglück geschuldet, dass durch kriegerische Einwirkungen etwa wichtige Informationen verloren gegangen wären. Nein, die Namenlosigkeit der damaligen Künstler, wir bewegen uns hier im hohen Mittelalter, war normal, war die Regel. Er war nur ein Handwerker, wie der Steinmetz und der Fußbodenleger, der zwar sein Handwerk verstehen sollte, aber irgendeine Individualität bzw. individuelle Genialität war nicht gefragt. Erst die neuere Zeit stellt diese Frage.
Welch Gegensatz zu der Auffassung von Kunst und Künstler, wie er die Zeit, beginnend mit dem frühen 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Die individuelle Handschrift, die individuelle Genialität des Künstlers werden zunehmend zum entscheidenden Maßstab, hinter den zunehmend sogar die formelle Beherrschung des darstellerischen Handwerks zurücktritt. Unmöglich für einen der moderneren Künstler ein Werk zu signieren, dass nicht ausschließlich aus seiner Hand stammt. Nichtübereinstimmung von Signatur und tatsächlichem Schöpfer bedeutet Fälschung, ist Straftatbestand. (Interessant in diesem Zusammenhang im übrigen, dass bereits das Altertum eine individuellere Auffassung des Künstlers besaß, als das Mittelalter. So ist uns der Name des Schöpfers der Nofretete-Büste als Thutmosis überliefert und die alten Griechen bezeichneten Phidias und Praxiteles als ihre größten Bildhauer.)
Zwischen dem anonymen Handwerker einer mittelalterlichen Bauhütte, wie man die zunftmäßigen Zusammenschlüsse der Bauleute verschiedenster Handwerke nannte, in den die die Kenntnisse des Bauens und Schaffens oft als kollektives Geheimwissen tradiert, und dem individuellen Genie der Moderne, steht jedoch in der europäischen Kunstgeschichte die Epoche der Werkstätten. Die Werkstatt steht für einen bestimmten Stil und für eine bestimmte Qualität, oder sollte Letzteres zumindest. Der Meister der Werkstatt gibt der in ihr produzierten Ware ihren Namen, da er eben für Stil und Qualität einsteht. Die Anfertigung ist aber kollektives, arbeitsteiliges Handwerk. Das sieht dann in der Regel so aus, dass der Meister für die Gesamtkonzeption steht, für die Proportionen und Haltungen menschlicher Figuren und in der Malerei für die Gesichter und Hände derselbigen. Für die anderen Körperteile ist er höchstens bei Aktdarstellungen zuständig. Ansonsten finden sich in der Werkstatt die Spezialisten für blaue Berge im Hintergrund, für Faltengewänder, für glänzenden Schmuck und für die Pferdeärsche der Reiterbilder. Und dann gibt es da vielleicht auch noch den Meisterschüler, der zur Not auch mal die Haltungen kann oder die Gesichter, so gut wie der Meister oder fast so gut.
Und da haben wir dann auch schon das ganze Zuschreibungsdilemma. Natürlich kann aus solch einer Werkstatt auch einmal ein Werk herausgehen, unter dem Namen der Werkstatt natürlich, an dem der Meister vielleicht keinen Strich getan, weil er vielleicht krank oder auf Reisen. Die Aufträge sind trotzdem zu erfüllen. Es ist deshalb ebenso wenig eine Fälschung, wie ein Ford oder ein Porsche, an dem kein Herr Ford oder kein Herr Porsche jemals eine Schraube fest gedreht. Und nun stellen wir uns noch vor, ein späterer berühmter Meister war in seiner Jugend zunächst Schüler bei einem anderen Meister. Da hatte er sich dann natürlich an den Stil des Meisters zu halten. Wie schwierig herauszufinden, was das Frühwerk einer späteren Berühmtheit war, zu einer Zeit, als er noch keinen eigenen Stil haben durfte, oder was vom Spätwerk in seinem Stil wirklich von seiner Hand.
Moritz Lampe: „Zwischen Endzeiterwartung und Repräsentation – Das Epitaph des Heinrich Heideck (1570 – 1603) aus der Leipziger Universitätskirche St. Pauli“, Plöttner Verlag Leipzig GbR 2009, ISBN 978-3-938442-68-5