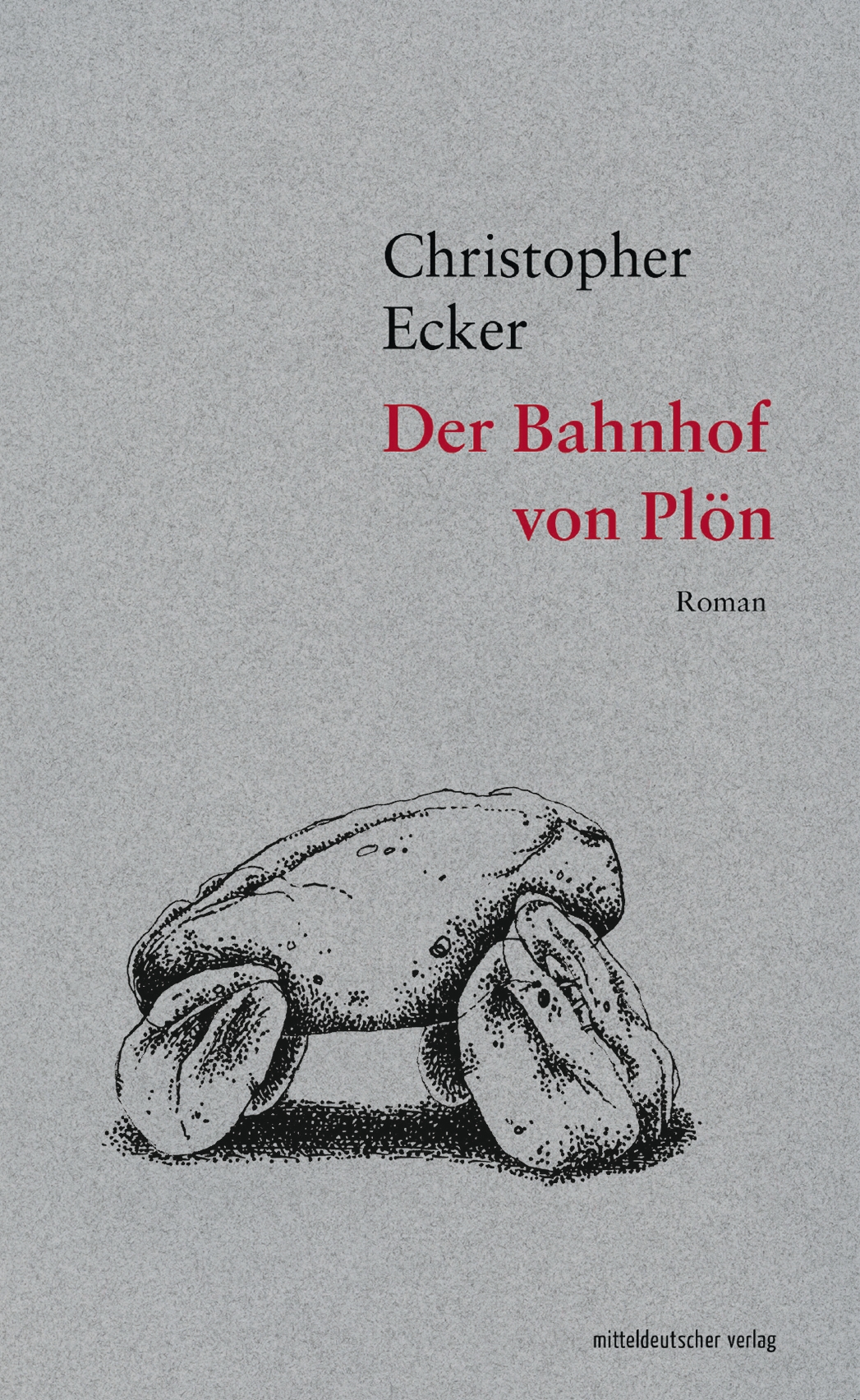Unter dem Keller, schreibt der Ich-Erzähler weiter, findet sich manchmal ein weiterer Keller, in welchem sich eine bisher übersehene Luke öffnen kann, die hinaus auf das Dach führt.
Warum, fragt er sich am Ende dieser beinahe über eine Buchseite reichenden Parabel, „…bin ich mein ganzes Leben lang im Keller geblieben? Und habe in ihm erst zu spät den Kerker erkannt?“
Christopher Ecker, beinahe ein halbes Jahrhundert alt und seit einem Jahrzehnt in der Kieler Provinz ansässig, legt einen neuen Haus-Roman vor. Nach „Fahlmann“ und „Die letzte Kränkung“ erscheint dieser Tage genau im Zweijahresrhythmus im Mitteldeutschen Verlag ein weiterer Ecker. Nach Tausendseiter und Novellenlänge ein Mittelgewicht. 396 Seiten benötigt der Autor diesmal, um uns brutalst zu verzaubern. Der schreibende (und mittlerweile von seinen Schülern zum Besten des Landes gekürte) Deutsch- und Philosophie-Lehrer entlässt seinen Helden Phineas aus einem wahrhaft gruseligen Hotel im heutigen New York in das Haus des Lebens. Nehmen wir an, dass die Ur-Geschichte dieses bösen wie erschütternd schönen Romans den Keller bildet, den Kerker und den Verlust – dann lassen wir das Märchen im tiefsten der Keller und betreten durch die Luke eine futuristische Killerstory auf dem Dach. Dazwischen liegt die ganze Welt, die Wanderung eines Unbehausten in Zeit und Raum. Die Kunst des Autors liegt vor allem darin, alle Ebenen so leichtfüßig wie glaubhaft zu verbinden.
„Das Handy vibrierte in der Hosentasche. Ich verfluchte meine Willfährigkeit, verließ die Haupthalle und schritt den marmorgetäfelten Gang zur Oyster-Bar hinab, der so breit war, dass dort zwei Kutschen bequem nebeneinander hätten fahren können.“
Haben Sie es bemerkt? Hier kommen in zwei Sätzen mehrere Jahrhunderte vor. Und direkt darauf folgt ein Satz (im Buch erreicht er 9 Zeilen!), der sehr weit zurückführt, in den Keller unter dem Keller unter dem…
„In der Königsfeste, die ich mit Vater bisweilen hatte besuchen dürfen, waren die ebenfalls unverhältnismäßig breiten Gänge von Kristallröhren an der Decke erhellt und nicht wie bei uns zu Hause von blakenden Fackeln im Winter oder Glaskugeln voller Heimchen im Sommer, die zu fangen den Kindern der Dienstboten und den kleinen Gästen oblag, sofern keine Gefahr bestand, dass sie uns davonliefen oder sich heillos im dänischen Wohld verirrten.“
Im nächsten Satz schaltet Phineas das noch immer vibrierende Handy aus und fühlt nach dem Nagel, der eine sprechenden Rolle einnimmt. Der Leser dieses abenteuerlichen und auf weite Strecken rätselhaften Romans ist mehrfach versucht, sich Klarheit zu verschaffen. Über das Internet findet man schnell heraus, dass die benannten Orte im nördlichsten Deutschland wirklich so existieren, dass es ein Schloss am See gibt, den Ort Plön, die Landschaft der Festen. In heidnischer Zeit mag es Stämme gegeben haben, die ihre steinernen Festen mit Fackeln beleuchteten, aber mit Glaskugeln voller Heimchen? Eine schöne Vorstellung, wie der Brückenwart und die sprechenden Tiere. Die Fähigkeit, von New York nach Paris oder Kiel zu „springen“, von einem Nagel lyrische Botschaften zu empfangen und Jahrhunderte in einer Kapsel zu verschlafen.
Christopher Ecker führt uns aus einer bedrückenden gewalttätigen Gegenwart mit ihren vielen Toten, zu Tötenden und totalen Überwachern immer wieder zurück in eine traumhafte Welt, die nicht minder gewalttätig, aber voller Wunder, war. Durch die Zeiten gekommen, ist der alkohol- und tabakabhängige Held Phineas heute der Unwissende an sich. Schwermütig, bedürfnis- und antriebslos erwartet er Befehle von einem „Lotsen“, welcher ihn herablassend und gleichzeitig unterwürfig behandelt. Phineas ist ein Prinz der verlorenen Festen. Einst dem Brückenwart und Diener Jérôme anvertraut, der ihn durch die Jahrhunderte zu schützen sucht.
In der Gegenwart trudeln zwei Verlorene in Richtung Alter und Untergang, beschnitten vom zunehmenden Versagen. Hilfe bringt das Lesen und das Schreiben. Wie beim Auftauchen aus einer seelischen Erkrankung nimmt der Anti-Held Schleier über Schleier von seinen Augen – und erfährt Linderung. Das Erkennen des Seins als Voraussetzung der Genesung. In diesen quälenden Prozess sind die verlorenen Tage der Festen eingeschrieben, auf die wir warten. Wir wollen das Raunen der Wälder hören, die Tanzplätze spüren und das Äffchen noch einmal sehen. Die Mutter, die wir alle verlieren…
„Unbehaustheit. Darüber zu schreiben lindert sie. Ein Paradoxon… Die Gefahren des Schreibens sind mir bewusst. Ich will nicht als jemand enden, dessen Leben allein dadurch fühlbar wird, weil er alles, was geschieht, getreulich aufzeichnet…“
Und doch liegt uns dieser poetisch grausame Bericht vor, der vielleicht nie in unsere Hände geraten wäre. Zum Glück hält einerseits der Verlag daran fest, regelmäßig die Schätze Eckers angemessen unter uns zu bringen, diesmal steingrau und bildhaft unter dem stimmigen Titel „Der Bahnhof von Plön“, den der Autor bereits vor vier Jahren der taz in einem Interview verriet – anderseits spielt der Autor mit eben dieser Autorenschaft. Wenn er den Erzähler, scheinbar in einer bürgerlichen Existenz als Lehrer angekommen, einen Kollegen ansprechen lässt.
„Wagen Sie es, die Wahrheit zu unterdrücken, Herr Ecker? Sind Sie Manns genug, dies alles als Ihre Schöpfung auszugeben, was ich Ihnen hiermit nachdrücklich erlaube, oder habe ich mich in Ihnen getäuscht?“
Für Ecker-Fans muss dieses Werk als bisherige Krönung gelten; blindes Stolpern des Helden durch eiskalte Welten, angetrieben von der Rasanz der Ereignisse, gebremst durch lukullische Exzesse und Rausch. Gerahmt vom Märchen der Festen. Gesprengt durch das Klaffen der Zweifel.
Betreten Sie wacker das neue Gebäude dieses großen Schöpfers, der uns nicht allein lässt mit den Niederungen der Gegenwart, der uns einlädt in seine Keller, um immer neue Luken zu entdecken und schlussendlich den Ausblick aufs Meer.
* * *
Christopher Ecker, Der Bahnhof von Plön, Roman, 400 Seiten, Mitteldeutscher Verlag, Halle Januar 2016, ISBN: 978-3-95462-530-7, Preis: 22,95 Euro (D)